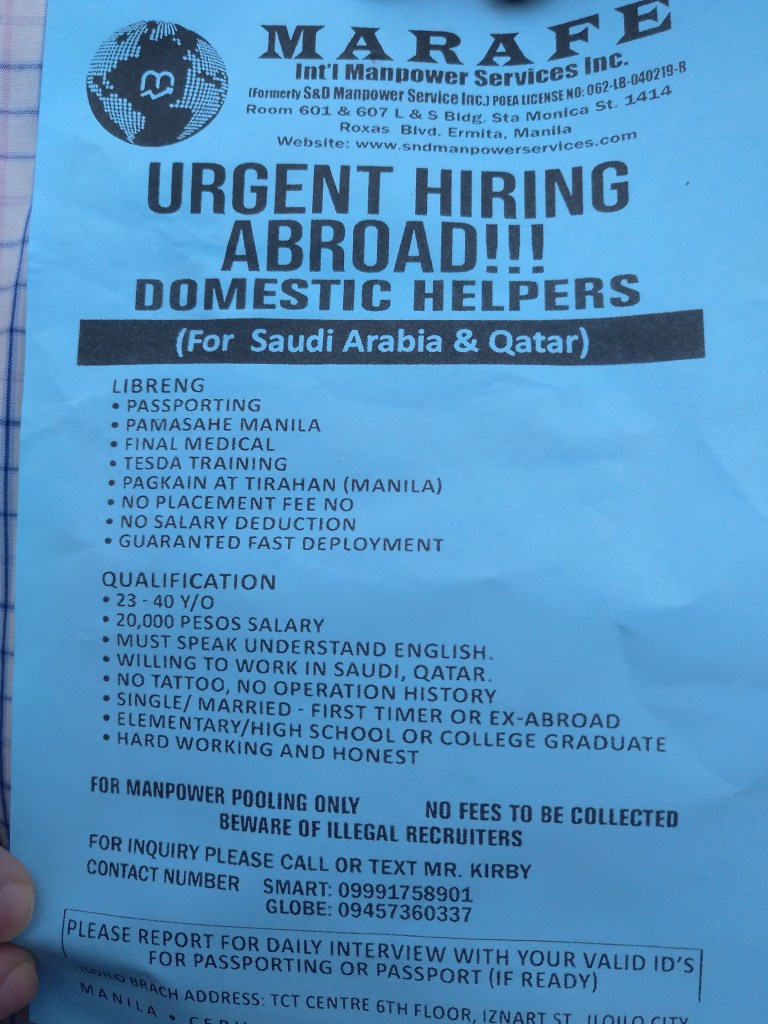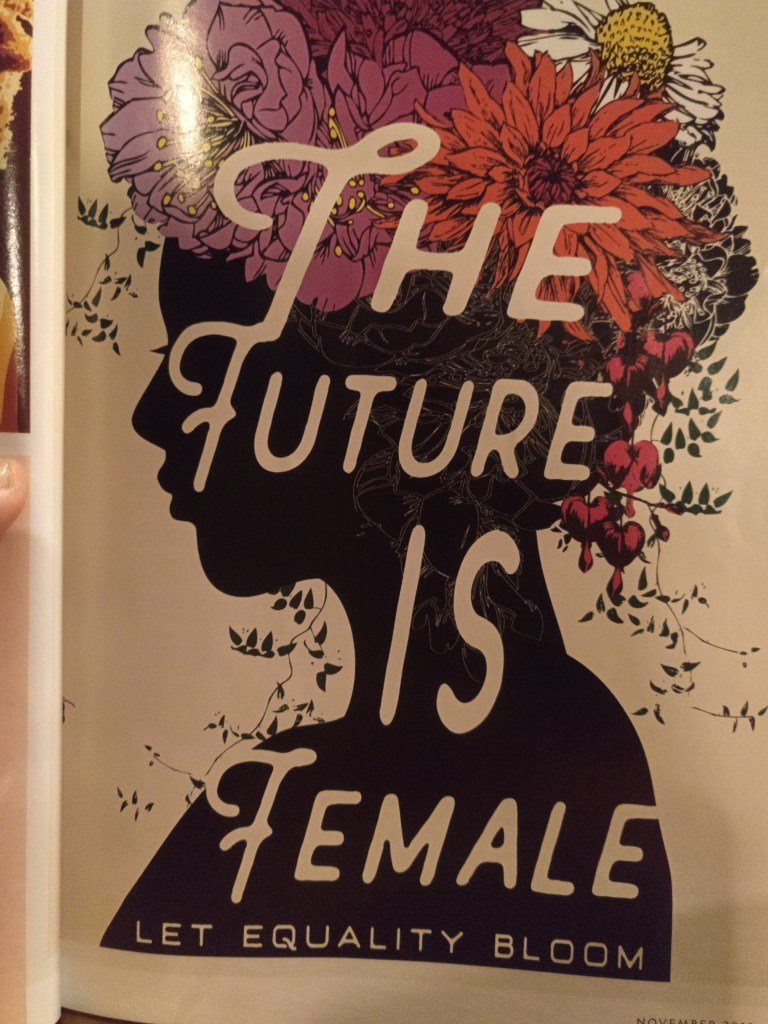In Iloilo wird am 4.Wochenende im Januar seit etwas mehr als 50 Jahren eine Nachbildung des Ati-Atihan von Kalibo, gefeiert. Das Fest hat sich inzwischen zu einer eigenständigen Attraktion vor allem für Einheimische entwickelt. Die Feier bezieht sich auf die Figur des Jesuskindleins, das die Negrenses und Cebuanos vor Angriffen der Moros, islamischer Piraten, geschützt habe. Diese Statue von Jesus bildet ihn als herrschaftliches Kind ab und wird heute als eigenständige Heiligengestalt verehrt. Historisch sei es die älteste religiöse Statue der Philippinen. Sie wurde von Ferdinand Maguellan 1521 dem Chef der Cebuanos, Rajah Humabon, verehrt, als sich dieser mit all seinen Leuten zum Christentum bekehrte. Im Dinagyang, dem Fest zu Ehren dieser Statue, heisst der Festruf „viva el Señor Santo Niño!“


9 Stämme tanzen und trommeln am Dinagyang. Rund 100 000 Besuchende strömen ins Stadtzentrum, um ihre Tänze anzuschauen, sich mit den Verkleideten abzulichten und an den vielen Ständen am Food Festival Leckerbissen zu geniessen. Die Darsteller tragen einen eigentlichen Wettbewerb aus mit kunstvollen Choreographien mit hunderten von Tänzern und Tänzerinnen. Begleitet werden die Darstellungen vor allem durch verschiedenste Trommeln. Viele davon sind aus Plastikfässern hergestellt. Wenn man fragt, womit die Feier vergleichbar sei, weisen Kenner auf Karnevale hin, nur dass es nicht „Hellau“ heisse, sondern „Viva el Señor Santo Niño!“ (es lebe der Herr heiliges Kind!). Wir wollten gerne das Ganze miterleben, waren aber zu spät, um eines der teuren Tickets für einen Platz auf den Bühnen bei den Festplätzen zu ergattern. Nur auf den streng abgesperrten Plätzen mit Bühnen führten die Stämme ihre kunstvollen Choreographien gesamthaft auf. Wir sahen zwar während des lockeren Einstimmungs-Umzuges am Samstag immer wieder Stücke aus den Tänzen, aber beim Hauptanlass am Sonntag sahen wir nur wippende Federn und hörten die Rufe und Trommeln von ferne, wie die meisten der Besuchenden. Dafür versuchte uns ein Typ mitten im Treiben Drogen anzudrehen. Als wir nicht wollten, insistierte er, wir sollten wenigstens aus seinem Schnapsbecher trinken, einen „free shot“ würden wir wohl annehmen wollen. Wir vermuteten, dass damit etwas „schräg“ war, etwa dem angebotenen Alkohol KO Tropfen beigefügt waren und haben freundlich abgelehnt. Seine Kollegen spähten zu verstohlen hinter der Ecke hervor, als dass wir nicht misstrauisch geworden wären. Passiert ist uns nichts. Wir konnten das Treiben auf den Strassen, die unbeschwerte Stimmung und die bunten Maskierten beim Posieren mit selfie schiessenden Asiaten gut beobachten und selbst als fröhlicher Teil in der Masse mitschwimmen. Alle freuten sich über das Fest.


Als offizielle Umzugsteilnehmende marschierten Angestellte von Banken, Versicherungen, Hotelketten und anderen Geschäften in koordinierten Gruppen beim Umzug mit. Es gibt viel Reklame, aber keine politischen Äusserungen, Witze oder Slogans. Das Dinagyang Fest ist rein ökonomisch-kulturell ausgerichtet.


Eine Schülergruppe als Teil des Umzuges.